Djuna Barnes: Nachtgewächs. st 2817
Es ist ein zu schönes Zitat, als das irgendein Text über Djuna Barnes (1892-1982), somit auch dieser nicht, ohne es auskommen könnte, stammt es doch zudem von ihr selbst. Sie sei „die berühmteste Unbekannte ihrer Zeit“, ihre Zeit, das waren die 1930er Jahre, als die US-Amerikanerin in Europa weilte und mit dem Nachtgewächs 1936, dem gleichen Jahr wie Brechts Dreigroschenroman, die Verehrung der zahlreichen Schriftstellerkolleg*innen bestätigte. Unter ihnen war sie tatsächlich eine Berühmtheit, ihre Bekanntschaften und vor allem die ihr wohlgesonnenen Lobspender lesen sich wie ein Who’s Who der klassischen literarischen Moderne, von Faulkner über Joyce, von Pound über Dylan Thomas, von William Carlos Williams bis T.S. Eliot, der ein Vorwort zu Barnes’ Nachtgewächs schrieb. Berühmt war sie innerhalb dieser Zirkel, ein klassischer writer’s writer, doch außerhalb dieses fest verankerten Platzes in der Literaturgeschichte wurde sie kaum wahrgenommen, wie auch ihre gewissermaßen nicht vorhandene Nachkriegskarriere beweist.
Schon Eliot warnt im Vorwort – und nimmt sich selbst als mahnendes Beispiel –, dass der kurze Roman kein Buch sei, das sich einem bei einmaligen Lesen erschließe. Die zugrundeliegende Handlung ist von fast schon banaler Einfachheit, zugleich natürlich, von der Geschlechterthematik – zumindest 1936 – abgesehen, klassisch. Robin, der Name schon uneindeutig, entflieht ihrer Ehe mit dem österreichischen Pseudo-Baron Felix Volkbein zu einer Frau, Nora Flood, verlässt diese allerdings ebenso wieder zugunsten einer oberflächlichen Amerikanerin, Jenny. Zurück bleiben allerhand äußerst unglückliche Personen und die einprägsamste Figur des Textes, der Doktor – ebenso wenig Doktor wie Felix Baron – ein ewiger Kommentator und Erklärer im Stil eines gealterten Oscar-Wilde-Dandys, der gern paradoxe aphoristische Erkenntnisse aneinander reiht – unter denen sich verbirgt, was alle Protagonisten des Romans bestimmt, eine tiefgehende Verzweiflung. Das Geschehen rückt darüber in den Hintergrund, es liefert zumeist nur den Anlass für Zusammentreffen, für die Möglichkeit des Gesprächs, die Dialoge bilden die eigentliche Grundlage des Buches, sind aber weit davon entfernt, sich selbst zu erklären.
Der so geistreiche und joviale Doktor, irischer Katholik, scheint um ein Bonmot nie verlegen. Die Armee: die Familie des Ehelosen! (32), Lachen ist des armen Mannes Geld! (46) und ähnliche Kalendersprüche gibt er ohne Unterlass zum Besten, doch selbst Felix, alles andere als ein von Intellekt durchdrungener Analytiker glasklaren Blicks, erkennt hinter der Fassade des Connaisseurs und Weltmenschen, dieser Doktor sei ohne Zweifel ein großer Lügner, aber ein wertvoller Lügner. Seine Gespinste schienen das Gerippe eines vergessenen aber groß angelegten Plans zu sein; irgendeiner Lebenshaltung, deren einzig überdauernder Gefolgsmann er war (44). Ein Relikt, Diener eines ausgestorbenen Adelshauses (44), eben ein Überbleibsel des bohèmehaften Dandytums, noch immer unterhaltsam, sprachlich brillant, aber aus der verlorenen Zeit, wer wüsste das besser als der dem untergegangenen K.-u.-k-Reich hinterhertrauernde Felix, dessen Familie jüdischer Herkunft sich eine blaublütige Vergangenheit zusammengebastelt hat, die nun ebenso wenig wert ist wie des Doktors scheinbar dem Alltag enthobenes Snob-Gehabe, im Gegenteil. Felix spürte den Ernst, die Melancholie, verborgen unter all dem Spaß und Fluch, den der Doktor äußerte (54). Und hinter dieser Kulisse entlarvt sich noch viel mehr als nur ein falscher Lebenslauf. Dass er kein Mediziner ist, geschenkt, dass er im falschen Körper geboren ist dagegen treibt ihn in den Wahnsinn – und die Armut.
Das alte Europa ist somit ein absterbendes, in der Scheinblüte befindliches. Robin, Felix’ Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes, der bei ihm verbleibt, sucht ihr – neues – Glück in den Vereinigten Staaten und bei einer Frau, Betreiberin eines Salons. Nora hatte das Gesicht all derer, die das Volk lieben. Ein Gesicht das böse wurde, als sie entdeckte, dass Liebe ohne Kritik Verrat am Liebenden wurde. Nora beraubte sich selbst für jeden Menschen. Unfähig sich selbst zu warnen, sah sie ständig um sich und fand sich verringert (65f), eine buchstäblich fatale Eigenschaft, als sie Robin nicht halten kann, die sich mit der bereits etwas ältlichen, überspannten Jenny einlässt, einer Frau ohne Eigenschaften. Die Worte, die aus ihrem Mund fielen, schienen ihr nur geliehen; wäre sie gezwungen gewesen, ihren eigenen Wortschatz zu prägen, so wäre es ein Wortschatz von zwei Wörtern gewesen: ‚ah’ und ‚oh’ (80), In Ihrer Versessenheit, etwas darzustellen, entweihte sie den wahren Begriff der Persönlichkeit (81), auch sie wird die unstete Robin nicht dauerhaft in ihren Bann ziehen können. Diese, selbst eine kaum greifbare Gestalt, hinterlässt verwüstete Menschen. Liebe wird zur Ablagerung des Herzens, analog in allen Graden den ‚Funden’ in einem Grab. Wie darin der vom Körper eingenommene Platz genau bezeichnet wird, das Gewand, das zu seinem anderen Leben notwendige Gerät, so wird ins Herz der Liebenden als unvergänglicher Schatten das eingeprägt, was er liebt (70), so bleibt es für immer erhalten, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es tot ist.
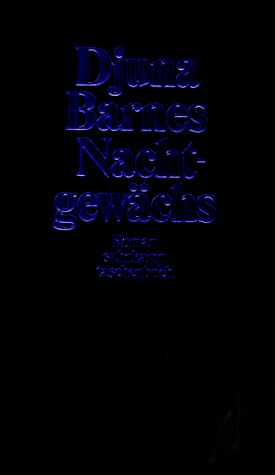
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen